Liebe Mitglieder des Ortsvereins Bonn-Köln der Deutschen Thomas-Mann-Gesellschaft, liebe Interessierte an unserer Arbeit,
Am 21.10. konnte der bereits mehrfach verschobene Vortrag von Prof. Dr. Norbert Oellers stattfinden. Unter der Überschrift ‚Bert Brecht und Thomas Mann‘ stellte er ausführlich dar, wie der Dramatiker auf der einen Seite und der Epiker auf der anderen mit den jeweiligen Mitteln ihrer hohen Kunst auf die tragischen Zeitläufte reagierten. Er wählte hierzu zwei jeweils ungefähr gleichzeitig entstandene Werkpaare aus: Zunächst stellte er „Die heilige Johanna der Schlachthöfe“ neben die Novelle „Mario und der Zauberer“, dann „Leben des Galilei“ neben den „Dr. Faustus“. Bei aller Unterschiedlichkeit hob Herr Oellers die einzigartigen Qualitäten dieser beiden bedeutenden Dichter deutscher Zunge in der ersten Hälfte des 20.sten Jahrhunderts hervor. Bei der anschließenden Diskussion wurden Fragen zu den persönlichen Beziehungen der beiden zueinander besprochen. Herr Prof. Oellers umriß deren Nicht-Verhältnis und hielt als ausgewiesener Fachmann für den Dramatiker Friedrich Schiller seine Ansicht nicht zurück, daß seine größeren Sympathien beim Dramatiker Bert Brecht liegen.
Weitere Gründe liegen auch im politischen und persönlichen Bereich. Im Sommer 1943 hatte sich Thomas Mann geweigert, eine Erklärung über die zu erhoffende Demokratisierung Deutschlands nach dem Ende des Krieges zu unterzeichnen, die vom Moskauer Nationalkonvent „Freies Deutschland“ veröffentlicht werden sollte. Seine Vorbehalte gegenüber Rußland mögen hier eine Rolle gespielt haben, aber auch sein grundsätzlicher Zweifel daran, daß man mit den Deutschen nach einem Kriege allzu gnädig umgehen sollte. In dem Text ‚Die Lager‘, der Mitte 1945 in verschiedenen, neu erscheinenden freien Zeitungen in Deutschland erschien, beschuldigt er keineswegs alle Deutsche, Täter gewesen zu sein, aber alle Deutsche seien eben bloßgestellt vor der Welt. Aber er läßt es auch nicht zu, die gesamte Schuld auf eine Führungsriege der Nazis zu laden:
„Es war nicht eine kleine Zahl von Verbrechern, es waren hunderttausende einer sogenannten deutschen Elite, Männer, Jungen und entmenschte Weiber, die unter dem Einfluß verrückter Lehren in kranker Lust diese Untaten begangen haben.“
In diesem Text erwähnt Thomas Mann auch den Münsteraner Bischof Graf von Galen und nennt ihn einen ‚unbelehrbaren Geistlichen‘, denn dieser hatte in seinem ersten Interview gegenüber der anglo-amerikanischen Presse gesagt, daß – obwohl er und andere gebildete Deutsche Antinazis wären – sie trotzdem „treu gesinnt sein müssten gegenüber dem Vaterland“ und sie daher die „Alliierten als Feinde betrachten müssten“. Ob Thomas Mann über das Wirken von Galens in den Nazijahren unterrichtet war, kann ich nicht feststellen, ich weiß nicht, ob Thomas Mann von dessen Predigten Kenntnis hatte, die die Machthaber bis aufs Äußerste reizten. Jedenfalls wurde dieser Text auch von Norbert Oellers‘ Vater Werner gelesen, und er schrieb einen, neben aller Respektbekundung leidenschaftlich erbosten Text wider Thomas Mann, der dann auch in der Ruhr-Zeitung veröffentlicht wurde. Er nennt Thomas Manns Sätze über von Galen einen „unqualifizierten Angriff“ eines Außenstehenden. Werner Oellers (1904-1947) war gläubiger Katholik und die Reden von Galens gaben ihm immer wieder die Kraft durchzuhalten, durchzuhalten in seinem Kampf gegen die Einziehung in die Wehrmacht, zu deren Musterungsterminen er seinen Körper mehrfach in einen so jämmerlichen Zustand versetzte, daß man ihn eben nicht einzog. Für diesen Einsatz bezahlte er mit seinem frühen Tod.
Prof. Oellers übergab mir den sehr eindrucksvollen Text seines Vaters nach der Veranstaltung, er hatte ihn bei sich auf dem Rednerpult. Der Text, überschrieben mit ‚Rettet die Seelen‘ ist nicht weniger eindrucksvoll als jener mit ‚Die Lager‘ überschriebene Text von Thomas Mann. Der vollständige Satz zu von Galen lautet wie folgt: „Fühlt euch selbst nicht, wie dieser unbelehrbare Geistliche, »in erster Linie als Deutsche«, sondern als Menschen, der Menschheit zurückgegeben…“ Kein Satz, gegen den es heute irgendwelche Einwände gäbe, und die Affäre zeigt, wie in jener unmittelbaren Nachkriegszeit in den zerstörten Städten die Nerven der Menschen zum Zerreißen gespannt waren.
Diese beiden Texte, nebeneinandergestellt, nacheinander verlesen, würde uns eine kleine Ahnung von der Situation verschaffen. Ich werde bei Herrn Oellers anfragen, ob er den Text seines Vaters für eine solche Veranstaltung frei gibt und ob er sich dabei beteiligen würde.
Es ist noch nachzutragen, daß die Veranstaltung aufgezeichnet wurde und demnächst online gestellt und mit unserer Homepage verlinkt wird.
Am Rande der Veranstaltung wurde über künftige Projekte gesprochen, leider schon wieder mit einem besorgten Auge auf die Entwicklung der Corona-Pandemie. Für das kommende Frühjahr bereitet die Co-Vorsitzende des Ortsvereins ein Programm über Thomas Mann, H. C. Andersen und die Vertonungen seiner Gedichte vor. Der Arbeitstitel lautet:
HANS CHRISTIAN ANDERSEN: Märchen und Gedicht-Vertonungen und ihre Spiegelung und Literarisierung bei Thomas Mann – Ein LIEDeraturabend für Gesang, Klavier und Sprecher. Lieder u. a. von Schumann, Grieg, Gade und Prokofieff
An einer Diskussion über Tóibíns ‚Der Zauberer‘ scheint kein Interesse zu bestehen. Ich habe den Roman nach hundert Seiten beiseitegelegt.
Abschließend möchte ich Ihnen noch zwei Bücher vorstellen, die in den zwanziger und dreißiger Jahre von Autoren aus dem persönlichen Umfeld von Thomas Mann verfaßt wurden:
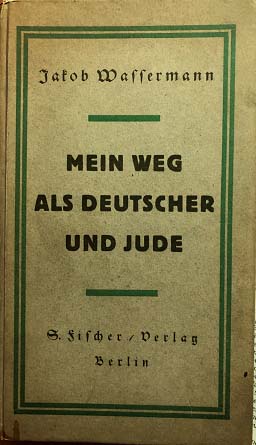
Jakob Wassermann: Mein Weg als Deutscher und Jude
Auf dies Buch wurde ich aufmerksam durch das Nachwort von Walter A. Berendsohn zu den ‚Sieben Manifesten zur jüdischen Frage‘. Es erschien 1921 bei S. Fischer in Berlin und hatte bei meiner Ausgabe von 1922 schon die 16. Auflage erlebt. Wassermann (1873-1934) war nach wilder und entbehrungsreicher Jugend seit Anfang des Jahrhunderts ein erfolgreicher Schriftsteller. Mit dem Erscheinen des ‚Caspar Hauser‘ setzte in der deutschnationalen Presse eine Empörungswelle gegen ihn ein, daß er „als Jude nicht fähig sei, ihr geheimes, ihr höheres Leben mitzuleben, ihre Seele aufzurühren, ihrer Seele sich anzuschmiegen“ und nun, als Mann von fast 50 Jahren gibt er einen Lebensabriß und eine Darstellung der fortwährenden Kränkungen und des Sich-zurückgesetzt-Fühlens in Deutschland aber auch in Österreich. Diese über Jahrhunderte gewachsene und auch von den Kirchen geschürte Aversion gegen die Juden hat auch die gebildeten Stände erfaßt. Die Texte lassen einen schaudern. Thomas Mann versucht ihn nach Erscheinen des Buchs zu besänftigen, spricht vom ‚Pflänzchen Antisemitismus‘, das in Deutschland keine Wurzeln schlagen könnte.
Nach Wassermanns Tod 1934 gibt seine Frau Martha Karlweis im Querido-Verlag 1935 eine Biographie ihres Mannes heraus, zu der Thomas Mann ein Vorwort schreibt. Darin heißt es:
„Wie maßlos er am Ende recht bekommen sollte, das ahnte er damals so wenig wie ich.“
Die beiden hatten sich schon als „ganz junge Leute“ kennengelernt im Gründungsjahr des ‚Simplicissimus‘ 1896, so Thomas Mann bei seiner Tischrede auf seinen „Freund“ Jakob Wassermann zu dessen 56sten Geburtstag. Kurz zuvor waren beide auf einer Liste „eines völkischen Kulturkampfbundes … als Kulturschädlinge und Seelenverderber“ bezeichnet worden. Dagegen führt Thomas Mann Wassermanns konservatives Rebellentum an: Er habe die besondere Art des Künstlertums bewahrt, die des genialen Unterhalters und Trostspenders. Diese gemeinsame Idee eines humanen Lebensdienstes bindet sie zusammen in dem „Kampf gegen die tödliche Trägheit des Herzens.“
Das Verhältnis der beiden zueinander ist eine eingehende Untersuchung Wert – wenn es eine solche noch nicht geben sollte, ich kenne sie nicht. Der Briefwechsel ist sehr umfangreich, die Textstellen, in denen sie aufeinander Bezug nehmen, ebenso. Aber vor allem möchte ich auf dieses Buch aufmerksam machen: ‚ Mein Weg als Deutscher und Jude‘! So altmodisch Wassermanns Sprache sich ausnehmen mag, so beschämend aktuell scheint mir der Inhalt dieses hundert Jahre alten Buches. Es hätte eine Neuauflage verdient.
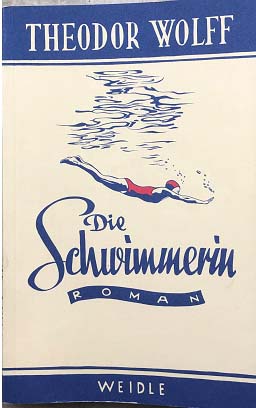
Gleichfalls beklemmend aktuell ist der gerade im Bonner Weidle-Verlag neu erschienene Roman von Theodor Wolff ‚Die Schwimmerin‘. Theodor Wolff war von 1906 bis 1933 Chefredakteur des Berliner Tageblatts – und somit einer der einflußreichsten Journalisten Deutschlands – bevor er sich nach Südfrankreich ins Exil begab. Dort traf er mehrfach mit Thomas Mann zusammen, Briefe wurden gewechselt. 1937 erschien ‚Die Schwimmerin‘ bei Oprecht in Zürich. Ein Ausschnitt seiner Beschreibung der mondänen Gesellschaft an der Côte d’Azur, des ebenso neuen wie befremdlichen Umfeld der beiden Dichter, soll die Sprachmacht Wolffs verdeutlichen:
Draußen auf dem Fahrdamm bewegte sich ununterbrochen, lückenlos und oft stoppend, der Korso der Autos, der pompösesten Autos aus allen Weltgegenden und Fabriken, ein riesiger Lindwurm, der sich mit blanken Schuppen langsam vorwärtsschob. In den Wagen saßen die gesicherten Existenzen, das Polster einpressend wie schwere Geldsäcke, und flittrige Grazien, indische Maharadschas ohne den verzaubernden Glanz ihrer Palastkostüme, populäre männliche und weibliche Filmstars, mächtige Zeitungsbesitzer, […] Fast alle taten, als wäre ihnen die Bewunderung der Zuschauer so gleichgültig wie in einer Rindviehausstellung den preisgekrönten Kühen.
Es soll keineswegs abwertend klingen, wenn ich sage, dies sei eine zur Literatur geronnene Reportage. Wolff benutzt die Folie einer Liebesgeschichte zwischen einem erfolgreichen Manager mittleren Alters und einer allzu jungen und dennoch auf Selbstbestimmung pochenden Dame für seinen Blick auf die gesellschaftliche Entwicklung Deutschlands seit dem ersten großen Krieg – der zweite ist schon als Ahnung zugegen. Besagte Dame trägt die Züge von Ilse Stöbe, von Wolffs früherer Sekretärin. Sie arbeitete 1939- 1941 für das Auswärtige Amt, und wurde, nachdem Sie Informationen zum geplanten Überfall auf die Sowjetunion nach Moskau übermittelt hatte, 1942 in Berlin als Landesverräterin hingerichtet. Gegen den Rat von Freunden bleibt Theodor Wolff nach dem Einmarsch der Deutschen in Frankreich. Im Mai 1943 wird er verhaftet und stirbt noch im September des gleichen Jahres.
Seit 1962 werden mit dem Theodor-Wolff-Preis herausragende Journalisten geehrt. Seit 2014 wird auf einer Gedenktafel am Auswärtigen Amt auf Veranlassung von Frank- Walter Steinmeier Ilse Ströbel gedacht.
Lassen Sie sich diesen Lesegenuß nicht entgehen und seien Sie herzlich gegrüßt Ihr Peter Baumgärtner
