Liebe Mitglieder des Ortsvereins Bonn-Köln der Deutschen Thomas-Mann- Gesellschaft, liebe Interessierte an unserer Arbeit,
aufgrund der vielfältigen Ereignisse ist dieser Rundbrief lang geraten. Also: Machen Sie es sich bequem, stellen Sie sich ein Gläschen Wein parat und dann kann es losgehen mit meinen Notizen zu den diesjährigen
Thomas Mann – Tagen
in Lübeck, und hier mit der Verleihung des
Thomas Mann – Preises an Navid Kermani.
Sie fand statt im Kammerspielsaal des Theaters und wurde moderiert von der neuen Leiterin des Buddenbrook-Hauses Frau Dr. Caren Heuer. Sie beklagte zurecht, daß die Bühne von der Stadt wie zu einer Trauerfeier dekoriert war, wonach der Lübecker Bürgermeister für Heiterkeit sorgte, als er den Preisträger mit „Herrn Kerami“ ansprach.
Dies wurde ihm aber verziehen, da er zudem verkündete, daß am Vorabend die Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck die notwendigen Mittel zum Umbau des Buddenbrook- Hauses freigegeben hatte. Nach dreijähriger Stagnation kann es nun endlich mit dem Projekt weitergehen. Man rechnet mit einer Fertigstellung im Jahr 2031.

Es folgte die Laudatio von Wolfgang Matz, dem Lektor von Kermani im Hanser-Verlag. Dessen literaturhistorische Einordnung war witzig, wenig verständlich und zu lang, aber er hatte mit seinen langen Gliedern eine eindrucksvolle Gestik, und da die ersten Gehversuche Kermanis Neil Young im Titel trugen, zog er plötzlich eine Mundharmonika aus dem Jackett und stimmte „Hard of Gold“ an.
Am Ende sprach Kermani zur Geschichte des Landes seiner Vorväter, zur Beziehung, ja Verflechtung seiner Familie mit eben jener Geschichte. Er führte aus, daß nicht 1989 der große Wendepunkt in der Nachkriegsgeschichte gewesen sei, sondern 1979 mit der Iranischen Revolution – wir können uns auf die Publikation seiner Rede im Jahrbuch freuen.
Zwischen den Beiträgen betrat alt und gebeugt Majid Derakhshani die Bühne, ein Weltstar der Langhalslaute, der auf Wunsch von Kermani geladen worden war. Virtuos entlockte er seiner ‚Tar‘ jazzig-meditative Klänge. Eine wunderbare neue Hörerfahrung.
Zur Veranstaltung am Samstagmorgen:
Thomas Mann kontrovers – Hans Castorp: Ein simpler Held?
möchte ich nicht viel Worte verlieren: Die FAZ berichtete darüber – den Artikel finden Sie im Anhang. Zwei für mich neue und herausragende Köpfe unserer Gesellschaft lernte ich dabei kennen: Frau Dr. Katrin Max – sie unterrichtet an der Hochschule in Leipzig – und Herrn Dr. Michael Navratil, Dozent an der Studienstiftung des Deutschen Volkes in Bonn – die anwesenden Mitglieder unseres Ortsvereins waren sich einig, daß wir ihn zum Vortrag einladen müssen – was ich am Abend auch tat. Eine Termin- und Themenabstimmung erfolgt in Kürze.
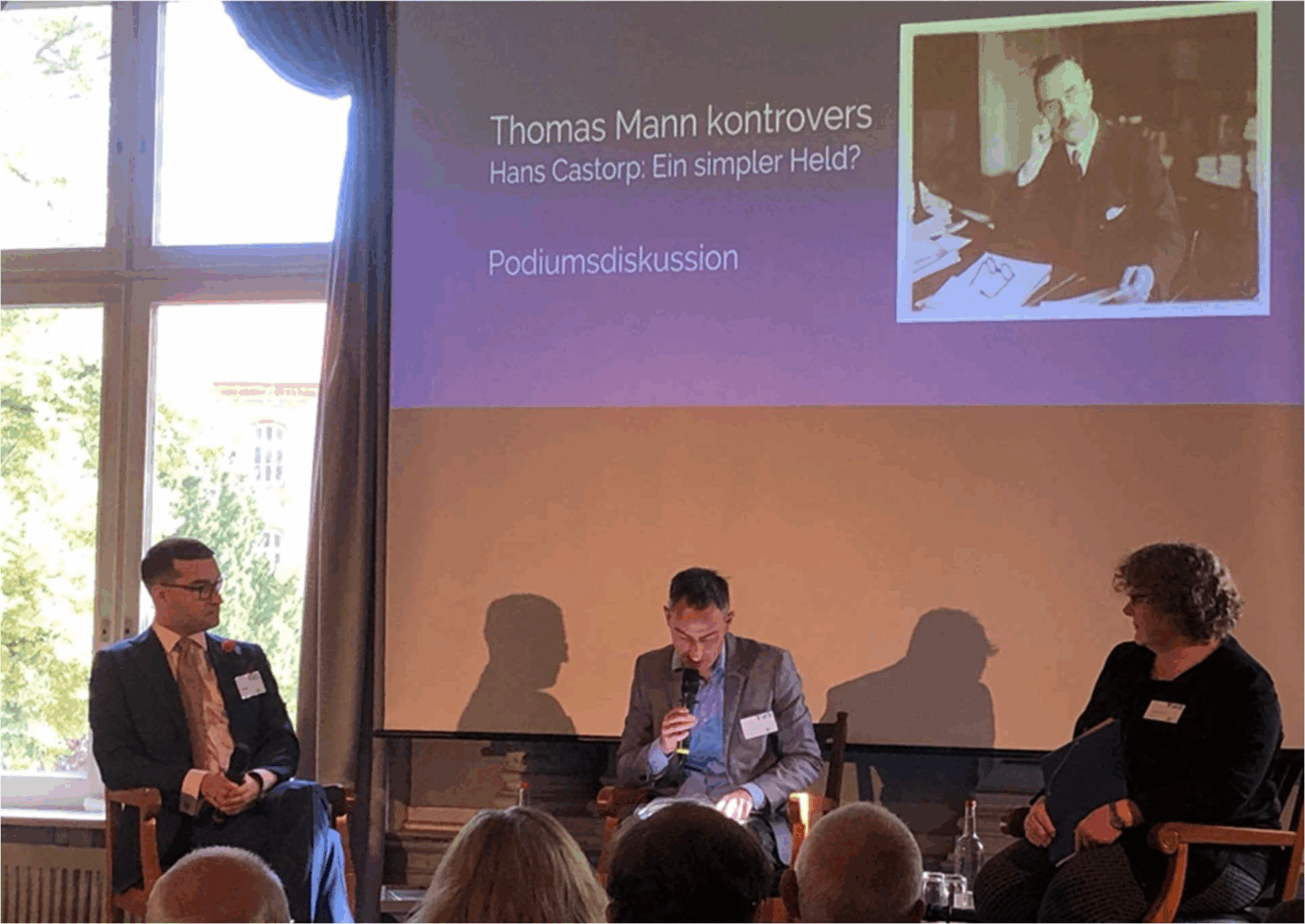
Mitgliederversammlung:
In diesem Jahr standen Vorstandswahlen an. Aus dem Vorstand traten zurück Frau Prof. Dr. Elisabeth Galvan und Herr Prof. Dr. Andreas Blödorn, für diese beiden wurden Frau Prof. Dr. Barbara Beßlich und Herr Oliver Fischer gewählt, der Vorsitzende des Ortsvereins Hamburg (sein Buch: «Man kann die Liebe nicht stärker erleben» erscheint im November bei Rowohlt – Er wird es in Bonn vorstellen). Außerdem bat unser Schatzmeister Herr Michael Haukohl um Entlastung, an seiner Stelle wurde Herr Henning Biermann gewählt.
Beim Beirat stellte die frühere Leiterin des Buddenbrook-Hauses ihr Amt zur Verfügung, an ihre Stelle trat Frau Dr. Caren Heuer, ihre Nachfolgerin im Amt. Als Vertreter des Jungen Forums wurde Jan Hurta in den Beirat gewählt, durch den „Aufstieg“ von Oliver Fischer in den Vorstand wurde im Beirat eine Position frei. Hier wurde nun Frau Dr. Katrin Max aus Leipzig und Herr Prof. Dr. Kai Sina aus Münster gewählt. Meine Wenigkeit wurde als Beirat im Amt bestätigt.
Meinen am Ende dann frei gehaltenen Vortrag bei der Mitgliederversammlung zu den Aktivitäten unseres Ortsvereins finden Sie im Konzept im Anhang. Hierbei bat ich auch Frau Dr. Natia Tscholadze auf die Bühne. Sie bedankte sich für die starke Unterstützung aus unserem Ortsverein bei der Gründung eines georgischen Thomas-Mann-Freundeskreises in Kuatissi, Georgien, berichtete vom dem großen Interesse an Thomas Mann in ihrem Land und von den stark steigenden Mitgliederzahlen. Neben ihr waren drei weitere Damen aus Georgien nach Lübeck gekommen, die beinahe akzentfrei Deutsch sprechen und sehr kenntnisreich zu Thomas Mann. Ich bedankte mich in diesem Zusammenhang bei Frau Ekaterina Horn, einer in Deutschland lebenden Landsfrau von Natia, die vor gut zwei Jahren die ersten Kontakte nach Georgien geknüpft hatte, und ich erinnerte daran, daß am 26. Oktober in diesem Lande richtungsweisende Wahlen stattfinden werden: Wohin wird sich das Land in den nächsten Jahren orientieren? Nach Westen oder nach Osten?
Am Abend gab es dann die Feierstunde zum dreißigjährigen Bestehen des Jungen Forums im Logenhaus – ich wollte es kaum glauben: Aber es gibt sie noch, die Freimaurer in Lübeck, und sie besitzen ein klassizistisches Gebäude mit einem herrlichen Saal…

In der Feierstunde wurde daran erinnert, wie skeptisch die jungen Leute damals beäugt wurden, und wie viele tüchtige und tätige Mitglieder unserer Gesellschaft inzwischen daraus erwachsen sind. Im übrigen schienen mir all die jungen Leute in ihrer Lebendigkeit und sprachlichen Brillanz als großes Hoffnungszeichnen wider den Unkenrufen zum sprachlichen Niedergang in Zeiten der sogenannten Sozialen Medien.
Am Sonntagmorgen stellte Heinz Strunk seinen in Kürze erscheinenden Roman Zauberberg 2 in der Gemeinnützigen vor. Er hatte schon verloren, bevor er überhaupt begonnen hatte: Der Romantitel wurde in unseren Kreisen als Zumutung empfunden, auch wenn Strunk sich dann redlich bemühte, seine Chuzpe zu begründen. Ich finde sein Anliegen völlig legitim, Thomas Mann hat kein Heiligtum geschaffen. Doch seine schnoddrig überschnelle Art zu lesen gab dem ganzen Text die Anmutung eines Roadmovies, der sprachlich nicht weiter entfernt von Thomas Mann sein könnte. Die Hauptfigur Heitbrink reist nicht ins Hochgebirge, sondern in eine Mecklenburgische Seenlandschaft, nicht in ein Lungensanatorium, sondern in eine Kurklinik für psychosomatische Erkrankungen. Edo Reents von der FAZ versicherte mehrfach, daß Strunk aus dieser Ausgangslage erzählerische Funken schlagen würde. Man war davon ausgegangen, daß Strunk bekannt ist, dieser seit 20 Jahren erfolgreiche Schriftsteller. Da hatte man sich getäuscht. Irgendwann stand auch Herr Wißkirchen auf und legte sich für den Autor ins Zeug, verwies auf das vorletzte Kapitel, das zu 80% aus Thomas Mann bestünde – aber da war es schon zu spät.
Dies nur als Schilderung des Ablaufs. Ich bin kein Literaturkritiker. Als Person war mir Heinz Strunk in seiner klugen und frech-witzigen Art sehr sympathisch.
Ich wollte ihnen mit diesen Schilderungen einen Eindruck davon geben, wie vielfältig und bereichernd eine solche Tagung ist. Die nächste Thomas-Mann-Tagung findet nicht im September statt, sondern vom 5. bis 9. Juni 2025: Zunächst wird in den 150. Geburtstag Thomas Manns hineingefeiert und dann viel darüber gesprochen.
In unserem Hotel war ich zufällig im Willy-Brandt-Zimmer gelandet, keiner üppigen Kammer, aber nett eingerichtet mit vielen Willy-Bildern an den Wänden, auch mit einer Tafel mit Auszügen aus dessen Erinnerungen: „Fünfeinhalb Jahre waren vergangen, als ich im Oktober 1938 in Paris, …, Heinrich Mann vorgestellt wurde. Die sieben Türme, so sagte er mit Tränen in den Augen und Trauer in der Stimme, …, werden wir wohl nie mehr wiedersehen.“
Womit die Überleitung zum nächsten Thema gelungen wäre: zu den
Tagen des Exils in Bonn,
zu unserer Veranstaltung am 10. September im Haus an der Redoute, zum Vortrag von
Prof. Friedhelm Marx „Thomas Mann im amerikanischen Exil“.
Wir hatten rund 35 Gäste, gut die Hälfte davon ganz neue Gesichter in unserem Kreis, was wir der Initiative der Tage des Exils der Körber-Stiftung zu verdanken haben.
Sein frei gehaltener Vortrag zu Thomas Manns Exil war sehr beeindruckend, beginnend der Schilderung des Vertriebenwerdens, von dem psychologischen Schock, auf einer Vortragsreise zu sein und zu erfahren, nie mehr nach Hause kommen zu dürfen. Diesen stelle ich mir grausamer vor als den materiellen. Ohnmächtig im Ausland sitzen zu müssen, während irgendwelche Barbaren sich seiner Habe bemächtigen und seine Bibliothek durchwühlen, muß für Thomas Mann schrecklich gewesen sein!
Marx blendete eine ganze Reihe von Zitaten aus den dreißiger Jahren ein, die in der Rückschau prophetisch anmuten, hinsichtlich der Gefügigmachung des Volkes zum Krieg, des Ausmerzens aller Gegenstimmen, die aber, in die Aktualität übertragen, allzu gut auf Putin und Konsorten zugeschnitten scheinen. Auch wenn sich Thomas Mann mit öffentlichen Äußerungen drei Jahre lang sehr zurückhielt, so erkannte er doch früh, wohin die Naziherrschaft strebte, und brachte dies in seiner unvergleichlichen Sprache zum Ausdruck.
Thomas Mann wurde das Bürgerrecht entzogen und die Ehrendoktorwürde von Bonn obendrein – hierzu mehr in einem der nächsten Rundbriefe. Nach Annahme der tschechischen Staatsbürgerschaft war er noch einige Zeit in der Schweiz, bevor er 1939 nach den USA übersiedelte, wo ihm Asyl gewährt wird, bevor er später die amerikanische Staatsbürgerschaft erhält.

Zurück ins Jahr 1939: Der Krieg liegt in der Luft, und Hitler sitzt fester als je zuvor im Sattel. Wird es je eine Chance geben, diesen Diktator zu stürzen? Thomas Mann engagiert sich stark in der Flüchtlingshilfe, sammelt viel Geld, um Einreisebewilligungen möglich zu machen und ist sich sicher, den Rest seines Lebens in seinem Gastland verbringen zu dürfen, mit dessen Präsidenten er sich freundschaftlich verbunden fühlt und dessen Grundwerte er teilt. In diesem Lande baut er sich ein letztes Mal ein Haus.
Doch nochmals hat sich Thomas Mann getäuscht, nochmals wurde er enttäuscht, auf eine rote Liste gefährlicher Kommunisten gesetzt. Wieder erhebt er seine Stimme, spricht von der Gefährdung der Demokratie in Amerika, Ähnlichkeiten mit der Gegenwart sind nicht zufällig.
Als Friedhelm Marx das Publikum dazu aufrief, Fragen zu stellen, hob ich sofort die Hand: Wann machen Sie ein Buch draus? Er machte uns Hoffnung auf eine Broschüre seiner Hochschule.
Bekenntnisse des Hochstaplers Thomas Mann…
… unter diesem provokanten Titel kommt im November ein „hybrider Dokumentarfilm“ in die Kinos. Ich wurde von der Produktionsfirma mindjazz-pictures aus Köln angeschrieben und um Kooperation gebeten. Bislang habe ich nur zurückhaltend auf diese Anfrage reagiert, zumal dessen Trailer einen ambivalenten Eindruck hinterläßt, den Eindruck einer Gleichsetzung der homosexuellen Aspekte der Krull-Figur mit Thomas Mann. Der Film nennt sich „hybrid“, da Spielfilmszenen im Wechsel mit Original-Filmaufnahmen von Thomas Mann gezeigt werden. Der Regisseur André Schäfer, so wurde mir mitgeteilt, „verzichtet vollständig auf neu gedrehte Interviews mit Expert*innen“ – und nun sucht man die Kooperation mit ebensolchen. Und dennoch werde ich gemeinsam mit Thomas Schmalzgrüber am 3.November der Einladung zur Premiere folgen – spätestens zum Stammtisch werden wir berichten.
Feuilleton
Auch hier wird es um Flucht und Vertreibung gehen:
Die Schauspielerin und Schriftstellerin Hertha Pauli spielte bis 1933 unter Max Reinhard in Berlin, war mit Walter Mehring und Ödön von Horváth befreundet, lebte dann bis 1938 in Wien, um nach dem sogenannten „Anschluß“ weiter nach Paris zu fliehen. 1970 veröffentlichte sie ihre Erinnerungen an die Jahre Ihrer Flucht unter dem Titel Der Riss der Zeit geht durch mein Herz. Ein ungemein fesselndes Buch, die „Innenansicht“ auf das Leben auf der Flucht ohne dickes Portemonnaie. Nach dem Fall von Paris geht es über weite Strecken zu Fuß nach Südfrankreich, neben Mehring sind Jozef Wittlin und Hans Natonek mit von der Partie. Letzterer kommt auf den Gedanken, Thomas Mann einen Brief zu schreiben und um Unterstützung zu bitten – und diese Hilfe kommt an, auch dank des unermüdlichen Einsatzes von Varian Fry, an den erst in neuester Zeit angemessen erinnert wird. (Uwe Wittstock hat in seinem jüngst erschienenen Bestseller Marseille 1940 auch aus diesem Werk geschöpft)
Allen vorgenannten – jüdischen – Schriftstellern gelang die Flucht in die USA, Walter Mehring konnte dort von seinen Tantiemen leben, Hertha Pauli wurde Kinderbuchautorin, Jozef Wittlin und Hans Natonek sind heute fast vergessen. Von ihrem Talent als Schriftsteller konnten beiden in den USA nicht mehr leben, Talente, die beide kurz vor Kriegsausbruch mit bei Allert de Lange in Amsterdam erschienen Romanen unter Beweis stellen konten. Diese will ich hier kurz vorstellen.
Hans Natonek wurde 1892 in Prag geboren und konnte als junger Mann seine erste Prosaskizze „Ghetto“ 1917 in der Textsammlung „Das jüdische Prag“ veröffentlichen, in der auch Franz Kafka seine Erzählung „Ein Traum“ unterbrachte. Das Leben in dem kulturellen Nebeneinander war der Nährboden seines Geistes. So ist es kein Zufall, daß sein Hauptwerk „Der Schlemihl“ das Leben des französisch-deutschen Schriftstellers und Naturwissenschaftlers Albert de Chamisso beleuchtet. Für Natonek ist er Symbol für die kulturelle Nähe von Frankreich und Deutschland, für einen Flüchtling vor den Fängen eines rücksichtslosen Welteroberers, für einen Freund der Juden, von Geist und Poesie ohnehin, von der Schönheit des Lebens. Kein modernes Buch, aber ein schönes.
Ich genoss seine pathetisch-poetische Sprache. 1938 erschienen, quasi als Mahnung und Gegenbild zur Gegenwart.
1941 kam Natonek mit dem Flüchtlingsschiff „Manhattan“ in New York an, er zählte 48 Jahre, hatte vier Dollar in der Tasche stellte er sich die Frage: „Wie oft kann man ein neues Leben beginnen?“ „Exil ist keine Lösung, die Sprache wandert nicht aus“, schrieb er 1961 an seinen Sohn nach Deutschland. In den USA schlug er sich zunächst als Leichenwäscher durch, bevor er Deutsch, Französisch und Geschichte unterrichten konnte.
Józef Wittlin wurde 1896 in Galizien auf dem Gebiet der heutigen Ukraine nahe Lemberg in eine jüdische Familie hineingeboren. Vielsprachigkeit war in den Weiten von Österreich-Ungarn selbstverständlich, seine Mutter war Deutsche, 1915 machte Wittlin in Wien Abitur und war dort mit Joseph Roth befreundet. In Paris fanden sich die beiden auf ihrer Flucht wieder, Roth ertrank vor Kummer im Alkohol, Wittlin machte sich nach Kriegsbeginn mit Hertha Pauli, Hans Natonek und vielen anderen auf den Weg in den Süden Frankreichs. Nach der gemeinsamen Flucht in die USA konnte er nicht mehr als Schriftsteller Fuß fassen. Von 1952 an war er Mitarbeiter des vom US-Kongress finanzierten Senders Radio Free Europe, der in mehreren Sprachen Programme in den Sowjetblock ausstrahlte. Später wurde er Lehrer.
Kurz vor der Flucht aus Paris gelang es ihm, seinen großartigen Roman Das Salz der Erde fertigzustellen. Er erschien 1937 bei Allert de Lange und wurde seither mehrfach neu aufgelegt, zuletzt 2014 bei S. Fischer.
Der ganze Roman ist ein großer prophetischer Klagegesang. Berückend im Ton, ein elegisches Andante, das so ganz im Gegensatz steht zu den tragischen Ereignissen ringsum, dem Beginn des Ersten Weltkrieges. Im Mittelpunkt steht der Bahnwärter Piotr Niewiadomski – zu Deutsch etwa: Peter Unbekannt – ein Analphabet, der die Welt mit vorurteilsfrei klaren Augen sieht, woraus der Roman seinen traurigen Witz erzielt. Der naive Piotr wird mit dem Hereinbrechen der großen Welt in sein kleines Leben konfrontiert, wird eingezogen, eingekleidet, gemustert und am Ende eingegliedert in das große Heer des gleichgeschalteten Kanonenfutters. Sie sind das Salz der Erde, das zertreten wird im Schmutz. Wittlin weiß, wovon er schreibt, war selbst zwei Jahre als Soldat an der Front, und er wußte auch, wie sehr man gläubige Juden im Heer verhöhnte.
Wittlin schrieb diesen Roman, als der nächste Krieg schon in der Luft lag, ihm ist ein großes Menetekel gelungen auf das, was Europa noch bevorstehen sollte. Und mit der biblischen Wucht des Titels endet der Roman auch: Der Stabsfeldwebel Bachmatiuk läßt über die neu eingekleideten und aller Seele beraubten Soldaten seine Blicke schweifen und stellt fest: Und er sah, daß es gut war.
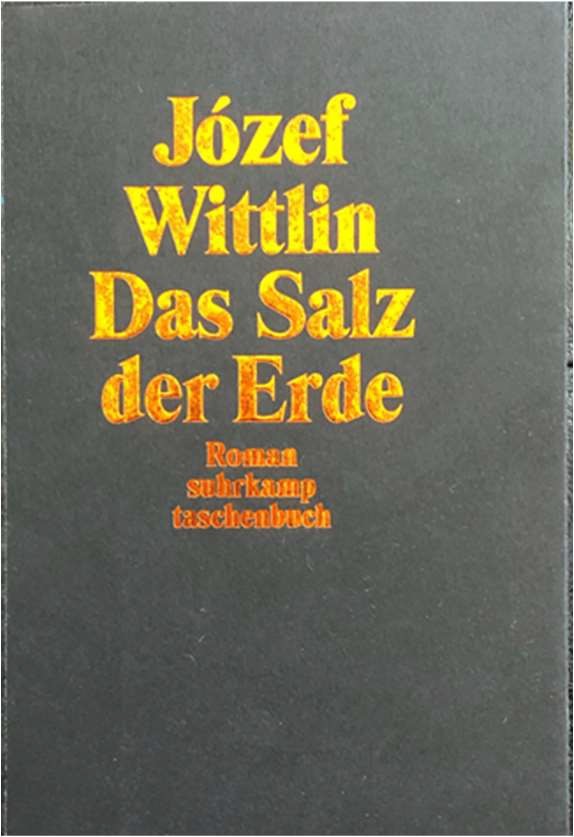
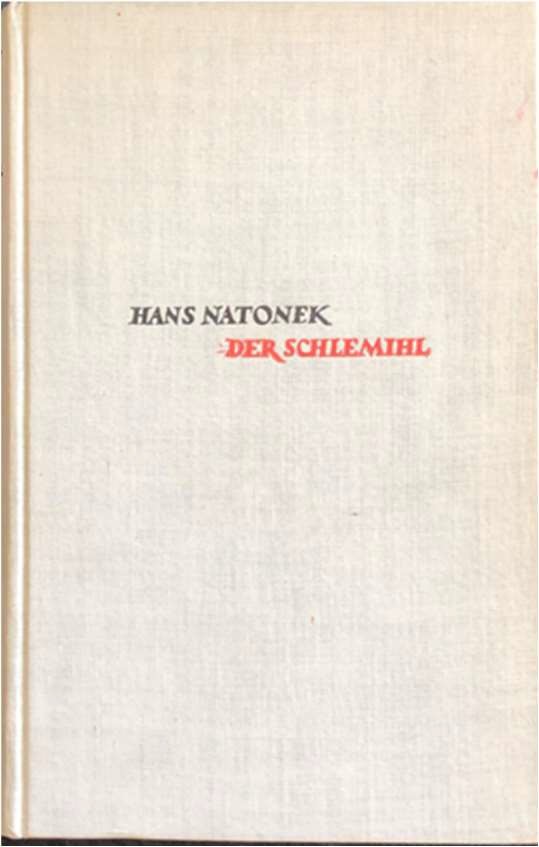
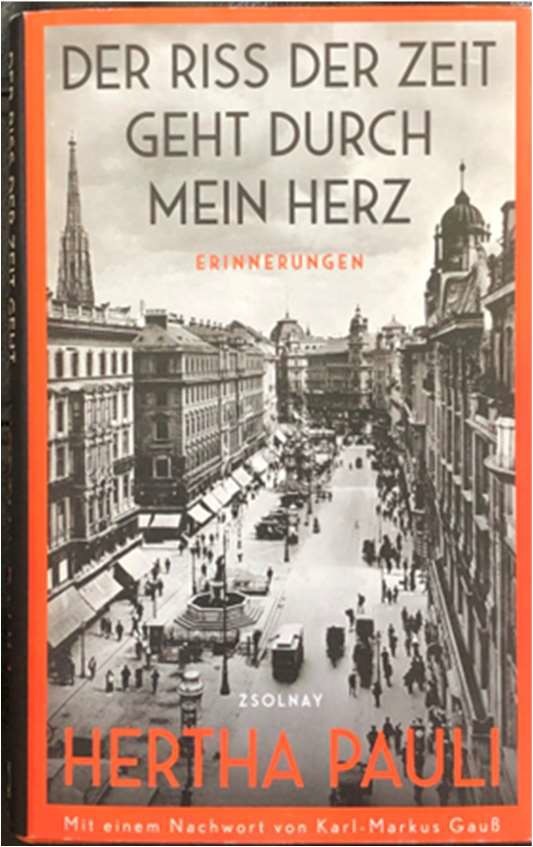
Stammtisch
Unser nächster Stammtisch wird im Gasthaus Nolden in Bonn-Endenich stattfinden, und zwar am Donnerstag, den 14.November um 18.00 Uhr. Bitte vormerken, weitere Details folgen.
Es grüßt herzlich Ihr Peter Baumgärtner
Alle Fotos, sofern nicht anders bezeichnet, stammen von Peter Baumgärtner
