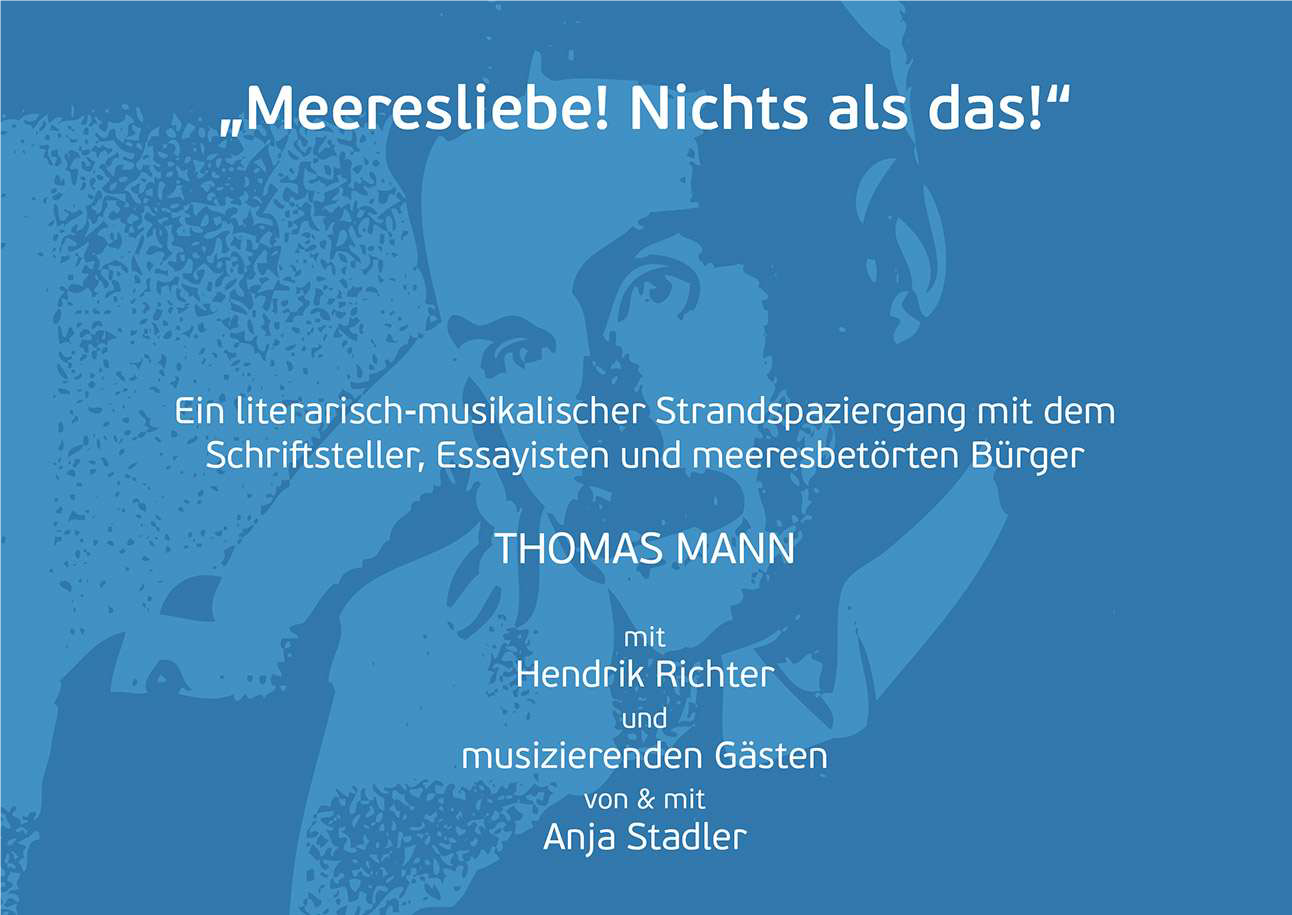Liebe Mitglieder des Ortsvereins Bonn-Köln der Deutschen Thomas-Mann- Gesellschaft, liebe Interessierte an unserer Arbeit,
die Anregungen der Jahrestagung werden uns noch lange beschäftigen, und dies taten sie auch beim sehr gut besuchten Stammtisch am 26.Juni. Der nächste wird am 14.August stattfinden, also am zweiten Donnerstag des übernächsten Monats, des vereinbarten Regeltermins also.
Ich stelle dies voran, da dieser Termin sich auch prominent dargestellt findet auf unserer neugestalteten Homepage https://thomasmann-bonnkoeln.de/. Schauen Sie sich um auf der Seite und geben uns bitte Anregungen und Kritik. Frauke May und ich haben in den letzten Monaten viel Zeit in die Sache investiert und wir sind der Überzeugung, daß wir nun wieder eine ordentliche Visitenkarte im Netz stehen haben.
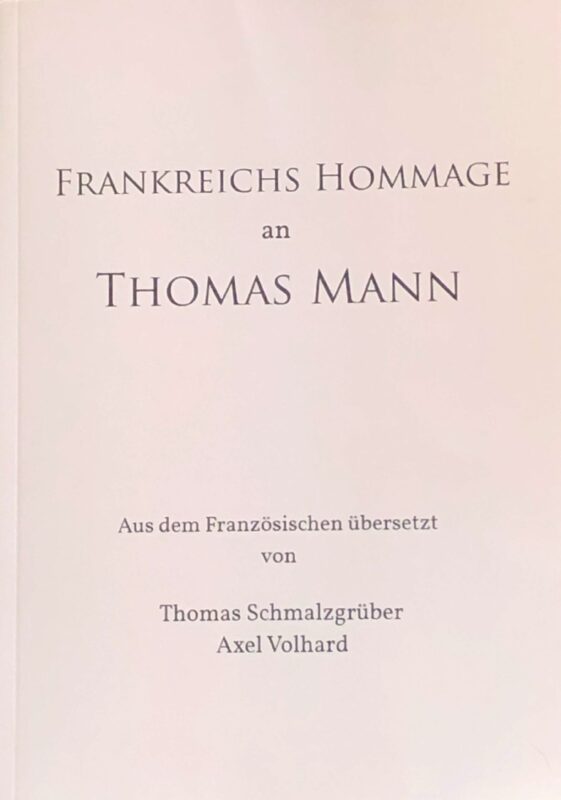
Der eigentliche Anlaß dieses Rundbriefs ist das Erscheinen der Übersetzung der Hommage de la France à Thomas Mann von Thomas Schmalzgrüber und Axel Volhard. Ich wiederhole die Namen dieser unserer Mitglieder bewußt, um ihre große Leistung hervorzuheben. Wir bringen damit ein Projekt zum Abschluß, das ich mit dem Rundbrief Nr. 51 vom 7. Mai 1923 angeschoben habe. Ich danke allerseits für den langen Atem und gestehe, daß ich erst jetzt, mit dem gedruckten Buch in Händen, die Texte erstmals vollständig gelesen habe, und zwar in dem Bewußtsein, daß sie an den noch lebenden Thomas Mann adressiert waren, daß die Gratulanten damit rechnen mußten, eine Stellungnahme des großen Meisters zu erhalten – erhielten sie wohl nicht! In den wenigen und ereignisreichen Wochen zwischen dem 80. Geburtstag 1955 und seinem Tod wird er kaum die Zeit gefunden haben, sein auf Japanpapier gedrucktes Exemplar sorgfältig zu lesen.
Treibende Kraft hinter der Hommage war Martin Flinker (1895 – 1986), ein aus Österreich-Ungarn stammender Buchhändler, Verleger und Schriftsteller, dem es 1938 nach dem Anschluß gelang, mit seinem Sohn Karl nach Frankreich zu fliehen. Vor der deutschen Besatzungsarmee ging die Flucht weiter nach Marokko. Nach dem Kriege eröffnete er eine Buchhandlung in Paris und war offenbar außerordentlich umtriebig, baute sich ein riesiges Netzwerk auf, was die Hommage beweist.
Der Name Flinker taucht im Tagebuch Thomas Manns mehrfach auf, es gab vielfach Korrespondenz und am 11. August 1953 hatte er „Lunch mit Flinkers, Vater und Sohn, im Garten von Schönau in Erlenbach.“ Am 9.März 1955 kündigt Flinker die Hommage brieflich an, „auf die ich mich sehr freue“, notiert Thomas Mann im Tagebuch, zumal „Staatsmänner, Auriol, Schuman, Mendès-France“ darin zu Wort kommen.
Jener Robert Schuman hatte als französischer Außenminister am 16. Dezember 1953 Thomas Mann in Zürich das Kreuz der Ehrenlegion verliehen. Ich muß sagen, daß keine Ehrung meiner Arbeit mir je soviel Vergnügen gemacht hat.
So viel einleitend zu der Wertschätzung, die Thomas Mann unmittelbar nach dem Kriege erfuhr. Aus dem Briefwechsel mit Agnes Meyer erfuhr ich zudem, daß Docteur Faustus in Frankreich ein sensationeller Erfolg war. Dies wird auch deutlich an den Namen von rund 150 Gratulanten aus Wissenschaft und Kunst, die den Texten der Hommage vorangestellt sind. Jean Cocteau und Jules Romains versuchten sich nicht in literarischen Exegesen, sondern hinterließen würdevolle Worte der Anerkennung. Albert Schweitzer (1865-1965) schickte aus Lambarene einen handgeschriebenen Glückwunsch.
Das Gros der Gratulanten kommt aus dem literarischen Betrieb, aus der Germanistik und der Philosophie. Ich habe mir die Mühe gemacht, die Lebensdaten dieser Personen zu ermitteln, die in Zeiten dreier deutsch-französischer Kriege aufwuchsen und sich als Germanisten mit dem „Erbfeind“ beschäftigten.
Jean Schlumberger (1877-1968) im „deutschen“ Elsaß geboren, war selbst Schriftsteller und ist eine interessante Figur, war Freund von Gide, und 1931 erwähnt ihn Thomas Mann in seiner Jungfranzösischen Anthologie in der Deutsch-Französischen Rundschau – so eine Zeitschrift gab es damals noch! Schlumberger läßt sich nicht auf eine literarische Abhandlung ein: Er gratuliert in persönlichen Worten.
Marguerite Yourcenar (1903-1987) stimmt zum Hohelied an, saust durch Manns Lebenswerk rauf und runter, auf den Punkt bringen könnte ich ihren Text nicht, ist sehr gebildet, fast möchte man ihr ein fishing-for-compliments unterstellen.
Robert d’Harcourt (1881-1965) ist der einer der wenigen, der in seinem kurzen Text die jüngere Vergangenheit mit in den Blick nimmt und damit auch den politischen Thomas Mann. D’Harcourt war Soldat im ersten Weltkrieg, katholisch-konservativer Ger- manist, arbeitete für die Resistance, zwei seiner Söhne wurden nach Buchenwald verschleppt, er publizierte bis zu seinem Tod 1965 über deutsche Nachkriegspolitik.
Robert Schuman (1886-1963) ist ganz nobler Politiker, Bruder im Geiste von Thomas Mann, studierte in Bonn, in der Königstraße ist eine Plakette für ihn angebracht.
Gabriel Marcel (1889-1973) war Philosoph, Vertreter des christlichen Existenzialismus – was auch immer das ist, vieles ist von ihm auf Deutsch erschienen, und ganz Philosoph beleuchtet er in erster Linie Manns Verhältnis zu Nietzsche.
Marcel Brion (1895-1984) war Romancier und Essayist, der ein vielfältiges Werk hinterließ. Er befaßt sich mit dem Fantastischen im Werk von Thomas Mann und sein Text kreist in erster Linie um die Erzählung Der Kleiderschrank (1899). Die Geschichte spielt außerhalb von Zeit und Raum in einem Schnellzug Berlin-Rom und die Hauptfigur heißt Albrecht van der Qualen –: Wie kann man nur solch tolle Namen erfinden!? Eine Gelegenheitsarbeit Thomas Manns und Fingerübung zum Broterwerb, und dennoch eine großartige Erzählung. Alles weitere sagt Brion sehr trefflich dazu.
Joseph Breitbachs (1903-1980) Ehrenrettung von „Königliche Hoheit“ macht Lust, eben dieses Werk mal wieder zu lesen. Breitbach war deutsch-französischer Journalist um Romancier, der sich stark für die Aussöhnung beider Völker einsetzte.
Antonina Vallentin (1893-1957) hat mich sehr beeindruckt! Geboren in Lemberg arbeitete sie in den zwanziger Jahren im Außenministerium unter Stresemann, über den sie dann auch eine Biographie verfaßte. Zudem schrieb sie über Einstein, Leonardo und Picasso. Sie war verheiratet mit Julien Luchaire, weshalb sie Thomas Mann in den Tagebüchern als „die Luchaire“ bezeichnete. Am 16. September 1933 war sie bei Mann in Südfrankreich zu Besuch – eben davon berichtet sie in ihrem Text in der Hommage. Sie zeichnet ein wunderbares Bild der Persönlichkeit Thomas Manns, dessen „schöpferische Sensibilität“ die sich aber stets seinen „tyrannischen Ansprüchen“ unterzuordnen habe. Der Text entstand unter dem frischen Eindruck der Lektüre des Doktor Faustus und des Romans eines Romans.
Sie schreibt, Thomas Mann habe sich zuweilen eine Aussage von Degas zu eigen gemacht: „Ein Bild ist eine Sache, die so viel List, Bosheit oder Laster erfordert wie die Verübung eines Verbrechens.“
Auch Edmond Vermeil, (1878-1964) Germanist, Lehrer von Alfred Grosser, ist noch völlig vom Faustus umfangen, vom Teufelspakt. „Ich glaube nicht, daß Thomas Mann irgendwo in seinem Werk so hoch gestiegen ist wie in dieser Meditation.“
Maurice Blanchot (1907-2003) lieferte den ausufernden Text: „Begegnung mit dem Dämon“. Er war eine eigentümliche Figur, gehörte vor dem Kriege den Rechtsnationalen an, war antisemitisch, danach Gegner von de Gaulle und am Ende Teil der 68’er Bewegung. Sein Beitrag kreist um den Faustus, er beschreibt quasi seinen eigenen Verdauungsvorgang, seinen inneren Kampf mit sich selbst – muß man nicht lesen.
Marcel Schneider (1913-2009) war ein französischer Schriftsteller aus dem Elsaß, der auf dem Père Lachaise bestattet ist. Er war nebenbei auch Musikfachmann und schrieb daher einen bewundernden Beitrag mit dem Titel „Thomas Mann und die Musik“. Zentraler Satz: „Wie jeder Humanist gibt Thomas Mann der Kunst kein moralisches Ziel, sondern eine moralische Bedeutung.“
George Duhamel (1884-1966, Vater von Antoine Duhamel) Schriftsteller, Arzt im ersten Weltkrieg, faßt sich kurz, selbstbewußt und endet mit einer liebevollen Spitze am Ende.
Martin Schlappner (1919-1998) lebte in der französischen Schweiz, promovierte 1947 über Thomas Mann und verdiente sein Geld als Filmkritiker. Sein Text Das Moralistentum Thomas Manns und André Gides ist ein weit ausholender und kenntnisreicher Aufsatz über eben dieses Thema, hat aber nur am Rande etwas mit einer Hommage zu tun. Erst im vierten und letzten Kapitel kommt es zu so etwas wie einer Würdigung
Thomas Manns: Es gibt zwei Ich in ihm, das Bürger-Ich und das Künstler-Ich. Worüber in den nächsten 70 Jahren viel geschrieben worden ist.
Piere-Paul Sagave wurde 1913 in Berlin als Peter Paul Sagawe geboren, ging 1931 als Student nach Frankreich und blieb dort, weil er nicht nach Nazi-Deutschland zurückwollte. Er begegnete Thomas Mann 1933 in Sanary und blieb mit diesem brieflich in Kontakt. Als Germanist unterrichtete er in verschiedenen französischen Hochschulen und starb 2006 in Paris. Er ist der erste in der Hommage, der sich zu den Betrachtungen äußert, und er tut dies sehr differenziert und dezidiert zugleich.
Louis Leibrich (1903-1983), Germanist und einer 1954 erschienenen französischen Thomas Mann Biografie, gelingt unter dem Titel Die Spiritualität Thomas Manns auf vier knappen Seiten ein schönes Gesamtbild des Autors. Der erste in der Hommage, der den Brief an den Dekan erwähnt und auch die Ansprachen Deutsche Hörer.
Aber es meldeten sich auch zwei Musiker zu Wort, so der damals noch junge Pierre Boulez (1925-2016) mit einem kurzen Text, in dem er die Darstellung der Zwölftontechnik im Faustus würdigt; und Maurice Boucher (1862-1962) Komponist, Schüler von Fauré, Gewinner des Rompreises, – schreibt über die Literatur Thomas Manns in tiefgründiger Klarheit und zudem mit Humor: „Ich wollte weder den Weihrauchschwenker vom Dienst noch den Beckmesser spielen“ schreibt er an einer Stelle, um etwas weiter zu seinem wesentlichen Punkt zu kommen: „Durch Mittel, die weitaus mächtiger sind als jene, die Historikern, Philosophen und Parteimännern zu Verfügung stehen, haben Sie wie kein anderer die Verunsicherung des menschlichen Daseins spürbar gemacht.“
Martin Flinker behielt sich vor, seine Hommage ans Ende des Buches zu stellen. Unter dem Titel Thomas Mann und das Problem der Einsamkeit entwirft er uns das Bild eines feinfühligen Autors mit einem positiven Frauenbild und dem Erfinder von gebrochenen Männerfiguren. Eine sehr moderne, zeitgemäße Betrachtungsweise.
Nun hoffe ich, Ihnen hinreichend viel Lust auf die Lektüre der Hommage gemacht zu haben. Unsere erste „Auflage“ von 25 Stück ist fast vergriffen. Bestellen Sie rasch bei mir, dann wollen wir versuchen, die notwenigen Exemplare zum nächsten Stammtisch vorliegen zu haben. Der Preis ist wie gesagt 15.- Euro, bei Postversand 20.- Euro.
Beim Stammtisch machte uns Frau Dr. Reinhardt auf eine interessante Ausstellung im Schloßmuseum Murnau aufmerksam: Die Malerin Olga Meerson (1882–1930) Olga Meerson war mit Heinz Pringsheim verheiratet, dem Schwager von Thomas Mann, war Schülerin von Kandinsky, Muse von Matisse – wer im Sommer im Bayrischen unterwegs ist, sollte sich diese Ausstellung nicht entgehen lassen.
https://schlossmuseum-murnau.de/de/olga-meerson
Kommende Woche Freitag findet in der Schloßkirche der Uni Bonn die Veranstaltung Meeresliebe! Nichts als das! statt. Ein literarisch-musikalischer Strandspaziergang mit Thomas Mann, veranstaltet vom litterarium. Den entsprechenden Werbeflyer habe ich angehängt. Ich bin an diesem Abend leider verreist. Ich denke, unser Ortsverein sollte vertreten sein!
Zuletzt finden Sie in einem anderen Anhang die Leseempfehlung von Patricia Fehrle zu Kerstin Holzers Buch Thomas Mann macht Ferien, das auch in Lübeck vorgestellt worden ist.
Holger Pils hat für Oktober sein Kommen zugesagt, er wird den von ihm herausgegebenen Briefwechsel mit Ida Herz vorstellen. Im Rundbrief Nr. 68 hatte ich die Biographie Ida Herz‘ vorgestellt: Die Archivarin des Zauberers. Gönnen Sie sich im Sommer die Briefe. Der genaue Termin und de Vortragsort steht noch nicht fest, aber bald auf unserer neuen Homepage!
Ich wünsche Ihnen angenehme Sommertage. Anmeldungen zum Stammtisch am 14. August, 18.00 Uhr, Delikart Bonn, nehme ich schon jetzt entgegen.
Beste Grüße ihr Peter Baumgärtner
Kerstin Holzer: „Thomas Mann macht Ferien. Ein Sommer am See“, KiWi 2025
Liebe Thomas-Mann-Begeisterte,
muss man dieses Buch lesen? Das habe ich mich vor der Tagung in Lübeck gefragt, denn zum 150. Geburtstag sind die Büchertische voll und die Sommerfrische am Tegernsee ist doch „nur“ eine kleine Episode. Auf dem Podium überzeugte mich Kerstin Holzer mit ihren Diskussionsbeiträgen sehr und nach kurzem „Anlesen“ in einer Kaffeepause kaufte ich ihr Buch.
Ergebnis: Ich kann es allen nur wärmstens ans Herz legen!
Warum? Die Autorin beschreibt zwei Sommerferienmonate 1918 der Familie Mann in Abwinkl am Tegernsee anschaulich und anekdotenreich. Sie selbst schreibt in ihrem Dank, dieses Buch handle „von einem Hund, einer Lebenskrise und der Liebe“. Das klingt simpel, ist aber doch schon eine Menge.
Und es geht um viel mehr als ein Idyll. Thomas Mann macht sich Sorgen wegen der bevorstehenden Veröffentlichung seiner „Betrachtungen“, die nicht mehr in die Zeit passen wollen. Wie Bauschan und der Tegernsee ihre heilsame Wirkung entfalten, schildert uns die Autorin locker und humorvoll.
Ein ganzes Kapitel widmet sie Katja Mann und sie beschreibt einfühlsam und mit großer Wärme die Beziehung zwischen Thomas und Katja: Das ist alles andere als eine „unglückliche Ehe“, auch sinnlich, trotz homoerotischer Neigungen! Die Autorin präsentiert Thomas Mann als Familienmenschen, der sich z.B. mit „Bauchmigräne“ dem Besuch von Schwiegermutter Pringsheim entzieht, aber des Abends regelmäßig romantische Ruderpartien mit Katja auf dem See genießt. Höhepunkt ist die Besteigung des Hirschberges, 1670 m hoch: „Einmal etwas Verrücktes tun!“, schreibt Kerstin Holzer. Das Erreichen des Gipfelkreuzes und der Ausblick bleiben Thomas Mann ein Leben lang im Gedächtnis. „Einen euphorischen Moment lang steht man über den Dingen.“, erklärt sie uns diese bedeutsame Erfahrung für den Dichter.
Kerstin Holzer stellt diesen Sommer am See gleichermaßen als Auszeit und eine Art Wendepunkt für den Schriftsteller Thomas Mann dar.
Das Buch ist leicht zu lesen, der Schreibstil ist anschaulich, flüssig, warmherzig und humorvoll. Kerstin Holzer beschreibt und deutet, mit Rückblicken und Vorausschau, aber sie manipuliert nicht. Eine wunderbare Sommerlektüre, die uns den Menschen Thomas Mann als solchen erlebbar macht und näher bringt!
Patricia Fehrle
,,Meeresliebe! Nichts als das!“
Freitag, 28.Juli 2025, 20:00 Uhr, Schlosskirche der Universität Bonn, Am Hof 1
Ein literarisch-musikalischer Strandspaziergang mit dem Schriftsteller, Essayisten und meeresbetörten Bürger
THOMAS MANN
mit Hendrik Richter und musizierenden Gästen, von und mit Anja Stadler